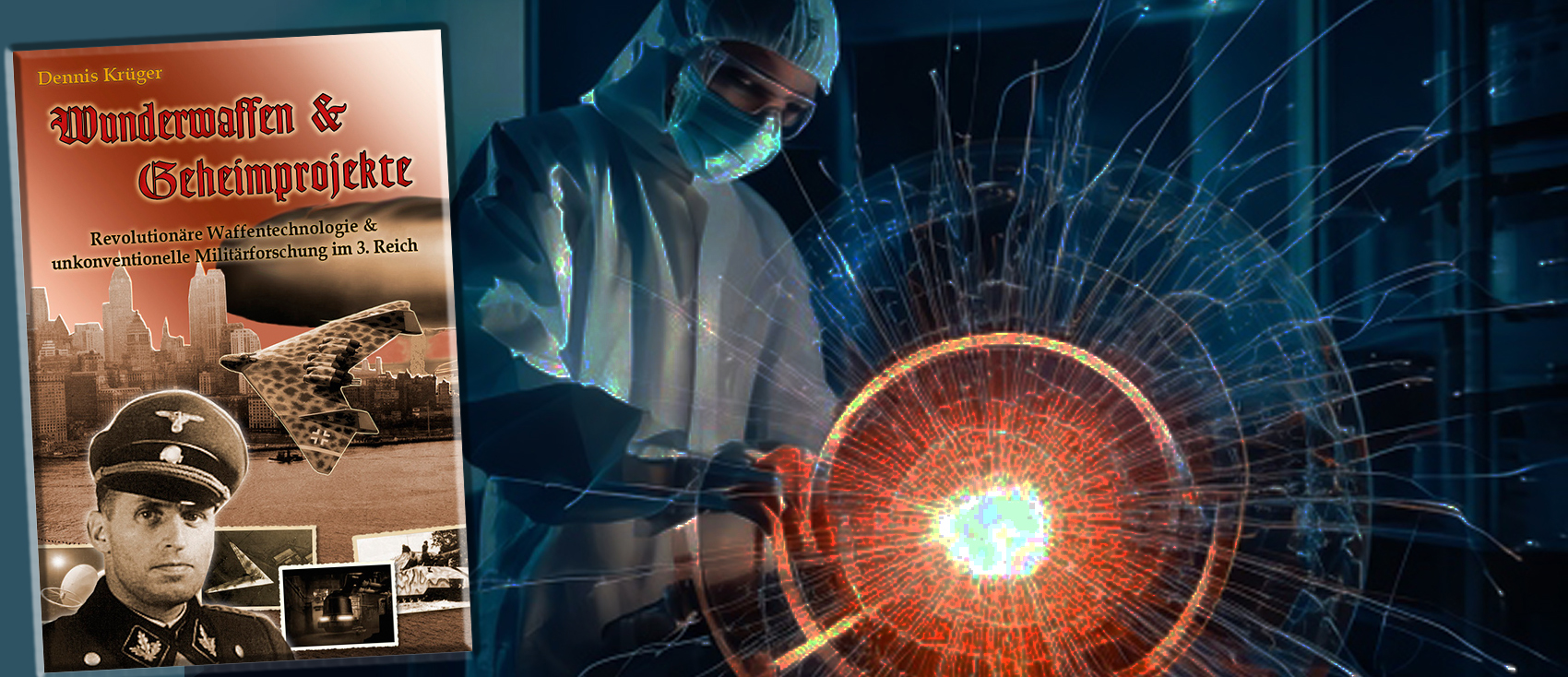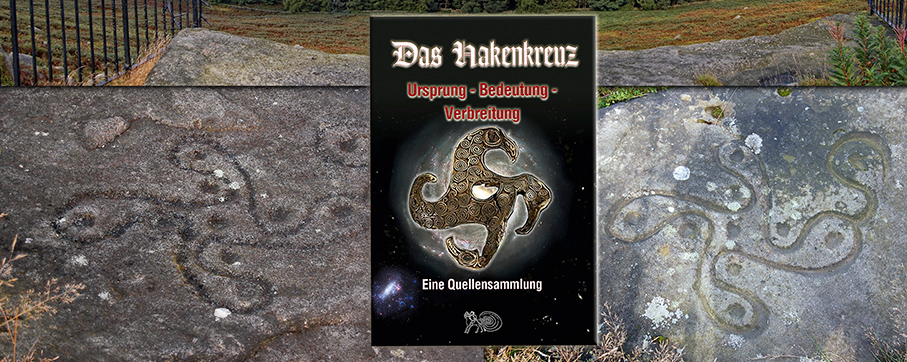Die Vorsehung stehe uns bei, daß diese Kriegstreiber erfolglos bleiben, denn wir würden in der Lage sein, uns dank neuer Waffenentwicklungen so zu wehren, wie es in der bisherigen Geschichte noch nie möglich war. In meiner Schreibtischschublade verfüge ich über Unterlagen zur Herstellung neuester, modernster Waffen, wozu mich nur ein Wunsch beseelt, sie nie zur Anwendung bringen zu müssen, weil sie alles übersteigen, was bisher als Kriegswaffe zur Verfügung stand.
Dieses Zitat Hitlers, das aus einem Interview mit dem deutschen Reichskanzler von 1939 stammt,1 gilt den meisten Historikern als Wunschtraum eines Phantasten. Denn die während des Krieges in Erscheinung getretenen Waffen — ob der Marschflugkörper V1, die Rakete V2 oder die deutschen Düsenjäger — vermochten allesamt nicht das Kriegsglück zugunsten der Deutschen zu wenden. Und daß Hitler mit seiner Aussage schon Atombomben oder ähnliche, tatsächlich kriegsentscheidende Waffen im Sinn hatte, kann wohl ausgeschlossen werden. Zumindest war dies lange Zeit Konsens der Forschung, bis nach und nach eine ganze Reihe von direkt auf eine deutsche Atombombe bezogener Gerüchte und Äußerungen diverser hochrangiger nationalsozialistischer Politiker bekannt wurde, die nahelegen, daß doch mehr hinter den Versprechungen der Wunderwaffenrhetorik gesteckt haben könnte.
So vermerkte der Sicherheitsdienst (SD) bereits im Juli 1943 „Erzählungen der Bevölkerung“ über eine „neuartige Bombe“. „Zwölf derartige Bomben, die auf dem Prinzip der Atomzertrümmerung konstruiert seien, würden genügen, eine Millionenstadt zu vernichten.“2
Diese Spekulationen dürften auf Äußerungen von hochrangigen Politikern, möglicherweise auch von an der Atomforschung beteiligten Personen zurückgehen. Im gleichen Jahr — 1943 — notierte etwa Reichspropagandaminister Joseph Goebbels in sein Tagebuch: „Die Forschungen auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung sind so weit gediehen, daß ihre Ergebnisse unter Umständen noch für die Führung dieses Krieges in Angriff genommen werden können. Es ergeben sich hier bei kleinstem Einsatz derart immense Zerstörungswirkungen, daß man mit einigem Grauen dem Verlauf des Krieges, wenn er noch länger dauert, und einem späteren Krieg entgegenschauen kann.“3
Bereits ein Jahr zuvor — Ende April 1942 — hatte Generaloberst Erich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres, geäußert, Kontakt zu einem Kreis von Wissenschaftlern zu unterhalten, „die einer Waffe auf der Spur seien, die ganze Städte vernichten könne.“4
Noch konkreter erscheint eine, freilich umstrittene, Äußerung des Rüstungsministers Albert Speer, der im Januar 1945 von einem Atomexplosivstoff so groß wie eine Streichholzschachtel gesprochen haben soll, der imstande wäre, „ganz New York zu zerstören“.5
Ähnlich äußerte sich auch der Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, der gegenüber seinem Leibarzt Felix Kersten eine „letzte Wunderwaffe“ erwähnte, die noch nicht zum Einsatz gelangt sei: „Ein oder zwei Schüsse und Städte wie New York oder London werden vom Erdboden verschwinden“.6
Ja sogar der italienische Duce Mussolini, sprach im Vertrauen auf seinen deutschen Verbündeten am 16. Dezember 1944 von neuen Raketen und Bomben „unglaublicher Macht“, die „eine ganze Stadt in einem einzigen Augenblick zerstören“ könnten.4
Schließlich bekräftigte Hitler selbst seit 1944 immer wieder in engstem Kreis seine Prophezeiung von 1939: Gegenüber dem erfolgreichen Schlachtflieger Hans-Ulrich Rudel bemerkte er, bald „fliegende Raketen“ einzusetzen mit „keinem normalen Sprengstoff“, sondern „etwas anderem, so gewaltigem, daß spätestens damit die Kriegsentscheidung fallen“ werde. Die Entwicklung dafür sei „schon weit fortgeschritten und mit der endgültigen Fertigstellung bald zu rechnen“. Gegenüber dem Oberstabsarzt Dr. Giesing wurde Hitler nach dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944 noch deutlicher: „In allerkürzester Zeit werde ich meine Siegeswaffen einsetzen und dann wird der Krieg ein glorreiches Ende nehmen. Das Problem der Atomzertrümmerung ist seit langem gelöst, und es ist soweit ausgearbeitet, daß wir diese Energie für Rüstungszwecke benutzen können…“4
Kann dies alles nur Wunschdenken verblendeter Fanatiker sein, wie nicht nur Medien wie die „Welt“ noch jüngst argwöhnten?5
Ein Blick auf den Verlauf der Atomforschung und die in den letzten Jahren zu Tage getretenen Erkenntnisse sprechen eine andere Sprache.
Der Beginn der deutschen Atomforschung
Nach der Landung der Westalliierten in Italien und der auch dadurch gescheiterten Kursk-Offensive im Osten (16. Juli 1943) setzten Hitler und die deutsche Wehrmachtsführung große Hoffnungen auf neue Waffenentwicklungen, welche die materielle und immer drohender zum Einsatz kommende Überlegenheit der Alliierten hätten ausgleichen können. Dabei spielten vor allem Waffen eine Rolle, die der herkömmlichen Geschichtsschreibung zufolge in Deutschland nicht existierten: Chemische, biologische und atomare („ABC“-) Waffen. Diese Tatsache dürfte viele Leser überraschen, herrschte doch bislang innerhalb der konventionellen Geschichtsschreibung die Meinung vor, entsprechende Waffen seien im 3. Reich nicht entwickelt worden. Zur Atombombe heißt es etwa im führenden Nachschlagewerk „Brockhaus“ (16. Auflage 1952, S. 477): „Die entsprechenden deutschen Versuche, die auf die Initiative des Heereswaffenamtes (Diebner) hin durchgeführt und von Heisenberg (Hechingen) und Bothe (Heidelberg) geleitet wurden, entwickelten sich zunächst vielversprechend, führten jedoch infolge Materialmangels nicht bis zum selbster-regten Uranbrenner. Der im April 1945 in Haigerloch gesprengte Versuchsbrenner besaß etwa 85 % der benötigten kritischen Mindestmengen von Uranmetall und schwerem Wasser. Atombomben sind in Deutschland nicht hergestellt worden.“
Ähnlich lauten die bisherigen Schlußfolgerungen zu chemischen und biologischen Waffen. Grundlage für die Erklärung, warum Deutschland hier, anders als in anderen waffentechnologischen Bereichen, hinter den Alliierten herhinkte, waren dabei zumeist zwei Erklärungsansätze: Aufgrund seiner Verletzung und vorübergehenden Erblindung in Folge eines Chemiewaffenangriffs im Ersten Weltkrieg habe Hitler eine natürliche Abscheu gegen chemische Waffen entwickelt. Die Atombombe hingegen soll Hitler entweder aufgrund strategischer Planungen — radioaktiv verseuchte Gebiete eignen sich schlecht für die Annektion — oder aus ähnlich gelagerten sentimentalen Regungen ebenso abgelehnt haben. Tatsächlich aber, so legen es zumindest neue Erkenntnisse nahe, gab es im Dritten Reich eine ausgedehnte Forschung an diesen so genannten „kriegsentscheidenden“ Waffen, die sogar erfolgreich zum Abschluß gebracht wurde — freilich ohne daß es zum Einsatz dieser Waffe kam.
In Deutschland existierte dank der weltweit führenden chemischen Industrie schon eine längere Tradition, chemische und physikalische Kenntnisse auch in die Waffentechnik einfließen zu lassen. 1936 wurde in Berlin das neue Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Physik eröffnet, das unter Leitung des bekannten niederländischen Physikers und Nobelpreisträgers Peter Debye stand, der ein Kältelaboratorium und eine zu jener Zeit einzigartige Hochspannungsanlage einrichten ließ. Zum Forschungsteam Debyes gehörten auch die beiden jungen Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirtz, die noch eine wichtige Rolle im deutschen „Uran-Projekt“ spielen sollten.
Im Januar 1939 gelang dem Direktor des gleichnamigen Institutes für Chemie, Otto Hahn, in Zusammenarbeit mit Fritz Strassmann und Lise Meitner der Nachweis der Kernspaltung. Im April des gleichen Jahres wurde darauf hin an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin eine „Arbeitsgemeinschaft für Kernphysik“, der so genannte „Uranverein“, eingerichtet.
Parallel dazu hatte das Heereswaffenamt (HWA) auf Betreiben des Hamburger Physiochemikers Paul Harteck im südlich von Berlin gelegenen Gottow, nahe dem Artillerieversuchsgelände Kummersdorf, ein Versuchslabor für eine neue Kernforschungsabteilung unter Leitung von Kurt Diebner aufgebaut — die einzige militärische Nuklearforschungseinrichtung bei Kriegsausbruch weltweit!
Der Grund dafür dürfte ein Brief gewesen sein, den Harteck und Otto Groth am 24. April 1939 an das Amt richteten, in dem sie die Herstellung einer Atombombe vorschlugen.6 Harteck selbst betrieb an der Universität Hamburg einen Uranmeiler, mit dem er bereits im Mai 1940 das weltweit erste Reaktor-Experiment durchführte.
Nach Kriegsausbruch wurde dann auf Betreiben des HWA, das in der Kernforschung schon früh ein waffentechnisches Potential erkannte, Diebner auch zum geschäftsführenden Direktor des KWI für Physik ernannt und ihm damit die führenden Kernforscher unterstellt. Bereits im gleichen Jahr wurde der Nobelpreisträger und Mitbegründer der Quantenmechanik, der Leipziger Ordinarius für theoretische Physik, Werner Heisenberg, für eine Mitarbeit gewonnen.
Da mit Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirtz die führenden theoretischen Atomphysiker innerhalb des KWI und damit unter dem Dach des Uranvereins versammelt waren, beschränkte sich der spätere Blick der Historiker auf diese Gruppe. Und tatsächlich gelang es diesen Wissenschaftlern weder einen Kernreaktor zum Laufen zu bringen, geschweige denn eine Atombombe herzustellen. Auch wenn die Gründe hierfür kon-trovers diskutiert werden, stand das Versagen der Deutschen in Bezug auf die Atombombenforschung lange fest und erhielt nach Freigabe der abgehörten Gespräche der im englischen Farm Hall internierten Atomphysiker nach dem Krieg vor wenigen Jahren scheinbar Bestätigung:
Denn Heisenberg selbst räumte hier ein, daß die Amerikaner ihnen wohl zuvorgekommen sind, die ebenfalls inhaftierten Gerlach und Diebner widersprachen nicht.7
Tatsächlich aber war die bislang ausschließlich im Blickfeld der Forschung liegende Forschergruppe um Heisenberg nicht die einzige und erst recht nicht die führende Kapazität auf dem Gebiet der Atomforschung.
So verfügten auch das Marinewaffenamt unter Leitung des Generaladmirals Karl Witzell und die Luftwaffe über eigene Atomforschungseinrichtungen, in denen die Nuklearkraft vor allem als mögliche Antriebsart neuer Entwicklungen erforscht werden sollte. Von der Arbeit beider Ämter haben aber nur wenige Aktensplitter das Kriegsende überdauert.
Unterschätzt in Bezug auf die Kernforschung wird aber vor allem die Rolle der Reichspost, deren Leiter Wilhelm Ohnesorge, wohl auch aufgrund seiner guten Kontakte zu Hitler, eine Reihe kriegswichtiger Projekte übernahm. Hier war unter anderem Manfred von Ardenne tätig, der in Berlin ein Zyklotronlabor betrieb.
Bereits 1941 hielt der Leiter der Reichspostforschungsanstalt (RPF), Prof. Friedrich Gladenbeck, eine Vorlesung für Offiziere der Wehrmacht mit dem aussagekräftigen Titel: „Die Bedeutung der Atomspaltung für den Bau einer Bombe mit bisher unbekannter Explosionskraft“.8
Wie erfolgreich die RPF in ihren Forschungen tatsächlich war, ist allerdings umstritten: Gerüchteweise war es gelungen, in einem bis heute unbekannten unterirdischen Standort im Harz Uran anzureichern. Dies äußerte zumindest Hitler nach Aufzeichnungen Henry Pickers im FHQ bereits Ende 1943:
„Die Serienfertigung dieser kleinen Atombombe sollte in einem unterirdischen SS-Werk im Südharz“ anlaufen, womit eine unterirdische Forschungseinrichtung (S-III) am Truppenübungsplatz Ohrdruf/Jonastal gemeint gewesen sein dürfte.9
„Diese kleine Atombombe“ bezog sich vermutlich auf eine Uraniumbombe, deren Herstellung man — anders als etwa bei der Plutoniumbombe — keinen Atomreaktor benötigte, den es frühestens 1944 gegeben haben kann. Vielmehr konnte für eine Uranbombe Uranium durch Isotopentrennung in speziellen, etwa von Harteck entwickelten Zentrifugen, Bagges „Isotopen-Schleusen“ oder von Ardennes Zyklotronen angereichert werden — verschiedene Methoden, welche den Deutschen zur Verfügung standen, nicht aber den Amerikanern, die dafür die viel langsamere Methode der Gasdiffusion verwendeten.10
Erfolge vor Kriegsende
Der wichtigste Organisator der deutschen Atomforschung blieb trotz der großen Erfolge Ardennes bei der RPF offenbar Kurt Diebner. Zwar trat er 1942 als Geschäftsführer des KWI für Physik zurück, arbeitete aber bereits seit 1939 im Rahmen des HWA in Gottorf an thermonuklearen Reaktionen durch Hohlladungen. Ab Januar 1944 wurde Diebner Stellvertreter des Beauftragten des Reichsforschungsrates für die kernphysikalische Forschung, Prof. Walther Gerlach in Berlin-Dahlem.
Mit Gerlachs Unterstützung setzte Diebners Team seine Arbeiten fort. Bis Frühjahr 1944 liefen die Vorbereitungen an einem Reaktorversuch in der Anlage in Gottow, die aber laut Nachkriegsdarstellung Diebners erfolglos abgebrochen wurden. Wie der Historiker Rainer Karlsch nun vor wenigen Jahren nachweisen konnte, wurde die Gottower Anlage bis Herbst 1944 weiter betrieben, nämlich solange, bis der Mehrstufenreaktor im vierten Anlauf (Versuch „G-IV“) endlich zum Laufen gebracht wurde.
Warum aber verschwieg Diebner, der bereits nach dem vorangegangenen Versuch G-III seine Vorgesetzten über die kurzfristige Machbarkeit einer Atombombe informiert hatte, diesen Erfolg? Dieses Schweigen muß um so mehr erstaunen, als er Mitte 1955, unmittelbar nach Aufhebung des alliierten Verbotes der Kernforschung innerhalb der BRD, ein Patent auf den Bau eines zweistufigen Reaktors anmeldete — eines Reaktors, der jenem von 1944 auffällig ähnelte.11
Neuesten Erkenntnissen zufolge war es der Gruppe um Diebner oder parallel forschenden Gruppen in den letzten Kriegsmonaten gelungen, doch noch eine Kernwaffe zu bauen. Während die offizielle Darstellung die Bemühungen deutscher Wissenschaftler im deutsch-amerikanischen Wettlauf um die Atombombe im Juni 1942 enden lässt, wurde tatsächlich weiter geforscht und wohl im Sommer 1944 ein Durchbruch erzielt, der zum „Prototypen“ einer Atombombe führte, die kurz darauf getestet worden sein soll.12
Dieser „Atomwaffentest“ soll auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf stattgefunden haben und war schon vor einigen Jahren von mehreren Forschern erwähnt worden. Jüngst bestätigte nun auch der Historiker Rainer Karlsch in der ersten Beweisführung mit akademischem Hintergrund zur deutschen Nuklearwaffe diesen Test, der dennoch bis heute umstritten ist.13
Die Tochter der früheren Hausverwalter der nordwestlich von Arnstadt und unweit Ohrdrufs gelegenen Wachsenburg, Claire Werner, erinnerte sich, daß am 4. März über dem Truppenübungsplatz Ohrdruf ein Licht zu beobachten war, daß „tausendmal heller gewesen sei als normale Blitze“. Die kurze Explosion sei „innen rot und außen gelb“ gewesen. Am folgenden Tag hätte sie ebenso wie viele andere Anwohner unter Nasenbluten, Kopfschmerzen und einem unangenehmen Ohrendruck gelitten. Am Nachmittag, so die Augenzeugin weiter, seien dann 100 bis 150 Wehrmachts- und SS-Männer im Ort eingetroffen, um Leichen zu beseitigen. Bei diesen habe es sich um bei dem Test umgekommene Insassen des Konzentrationslagers Ohrdruf gehandelt. Diese Angaben bestätigte der Zeuge Heinz Wachsmut, der gegenüber einem DDR-Untersuchungsausschuß aussagte, daß er an diesem Tag ebendort gemeinsam mit Soldaten und Häftlingen „Häftlingsleichen mit starken Brandwunden auf Holzstößen verbrannt hätte“. Überlebende des vermutlichen Waffentests hätten ihm gegenüber von einem gewaltigen Feuerblitz berichtet, der den Verletzungen vorangegangen sei. Schließlich habe ihm nach der Aktion ein SS-Mann anvertraut, daß die Häftlinge Opfer einer „neuen Waffe geworden wären, von der die Welt noch viel hören werde.“14
Laut Zeit-Online sollen insgesamt fünf Physikprofessoren durch Messungen bestätigt haben, daß „in Ohrdruf Spuren eines nuklearen Ereignisses vorhanden“ seien. Karlsch hält die hier verwendete Bombe für eine Art „schmutzige Bombe“, also eine konventionelle Spreng- bzw. Hohlladung, die mit nuklearem Material angereichert war, das durch die Sprengung eine thermonukleare Fusion auslösen sollte. Ähnlich die Einschätzung des britischen Forschers Mark Walker, der meint, die verwendete Bombe sei, „nicht mit den Atombomben zu vergleichen, die im folgenden August über Japan abgeworfen werden sollten“, aber immerhin einräumt, „daß eine Gruppe deutscher Wissenschaftler nach eigenem Dafürhalten zweifellos eine Kernwaffe entwickelte und testete“.15
Zwischen 2012 und 2016 von dem Ingenieur Peter Lohr durchgeführte Georadarmessungen von Objekten innerhalb unterirdischer Stollen im Jonastal sollen ebenfalls darauf hinweisen, daß hier Atombomben gefertigt und gelagert wurden. Dafür spreche laut Lohr sowohl die äußere Kontur als auch die sehr ungewöhnliche, asymmetrische Dichteverteilung mehrerer gemessener Körper. Diese wäre bei konventionellen Bomben aufgrund ihrer recht homogenen Sprengstofffüllung nicht erklärbar und könnte auf eine Atombombe nach dem Kanonen-Konstruktionsprinzip von „Little Boy“, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, hindeuten.16
Diebner und Gerlach jedenfalls hielten die neue Waffe und den damit verbundenen Test streng geheim. Keiner der anderen am Uranprojekt beteiligten Wissenschaftler, noch nicht einmal Heisenberg und Weizsäcker, erfuhren etwas davon.
Dafür daß die Nuklearforschung Diebners zur Fertigstellung einer Atombombe führte, sprechen indes noch weitere Hinweise:
So existieren US-Dokumente, die unter im thüringischen Stadtilm bei Kriegsende beschlagnahmten Gegenständen auch eine „Kleinst-Atombombe“ aufführten. Im nahe Ohrdruf gelegenen Stadtilm hatte Diebner im Herbst 1944 ein Versuchslabor eingerichtet und mit Uranwürfeln experimentiert. Ein Grund für den Wissenschaftler, seinen Erfolg nach dem Krieg zu verschweigen, könnte mit seiner Schweigeverpflichtung auch gegenüber der diese Nukleartests kontrollierenden Gruppe zusammenhängen: SS-Männern unter Leitung des 1943 zum Sonderbeauftragten des Führers für alle V-Waffen ernannten SS-Generals Hans Kammler.
Wie die Privatforscher Thomas Mehner, Edgar Meyer und Harald Fäth erstmals nach jahrelangen Recherchen herausfanden, hatten mehrere Gruppen Erfolg mit der Herstellung von Atombomben, so daß mindestens drei verschiedene Typen von Atomwaffen fertig gestellt wurden — zwei davon unter Regie der SS. Den Autoren zufolge hatte die SS bereits 1939 im Köln-Bonner Raum eine Forschungsgruppe zur Entwicklung atomarer Waffen eingerichtet, die während des Krieges um andere geheime Einrichtungen in Ohrdruf (Thüringen) und Pilsen (Böhmen) — möglicherweise auch bei Auschwitz — erweitert wurde, um 1944 erste „einsatzbereite Waffensysteme liefern zu können.“17
Genau in diesem Jahr, zeitgleich zum vermutlichen Durchbruch, den Diebner und SS-Ingenieur Dr. Seiffert im Juli 1944 beim Bau einer Atombombe erzielten, übernahm SS-General Kammler schrittweise die Kontrolle über die gesamte Atom-Forschung.
In einem Interview enthüllte der damalige Chefadjutant von Himmler (seit 1. April 1942), SS-Sturmbannführer Werner Grothmann im Jahr 2000, daß die SS-Nuklearforschung 5000 Personen bzw. Projekte beinhaltete, auf die nur wenige SS-Offiziere Zugriff hatten. Die verschiedenen Gruppen — neben Diebner, Gerlach und Werner Schwietzke wird auch eine Gruppe österreichischer Physiker erwähnt (Prof. Georg Stetter)— wurden von einer SS-Koordinierungsstelle kontrolliert, von der sich Himmler regelmäßig über den aktuellen Stand der Forschung unterrichten ließ. Im März 1945 soll Grothmann zufolge sogar ein SS-eigener Uranreaktor angelaufen sein.18
Ein deutscher Kernreaktor in St. Georgen?
Wo genau, dazu schwieg der ehemalige Chefadjutant. Nun liegen neue Erkenntnisse vor, daß sich dieser Kernreaktor im Gebiet der „Alpenfestung“ befunden haben könnte, und zwar bei St. Georgen an der Gusen. Hier wurde ein auffälliges Beton-Oktogon ausfindig gemacht, das an einen Reaktoraufbau erinnert. Unweit des mysteriösen Bauwerkes befindet sich das unterirdische Produktionswerk „Bergkristall“, das offiziell lediglich Me-262-Düsenjets produzieren sollte. Nunmehr aufgefunde Baupläne belegen aber, daß das Werk anders als bislang angenommen, nicht eingeschossig über acht km, sondern auf mehreren Ebenen fast 40 km umfaßte. Hier sollten, so Dr. Matthias Uhl, nicht nur Düsenjäger, sondern die tatsächlichen deutschen Wunderwaffen produziert werden, um den Kriegsausgang im letzten Moment doch noch zu wenden. Die wichtigste Waffe dabei dürfte die Atombombe gewesen sein.19
Reine Spekulation, wie etwa Welt.online in Reaktion auf den für öffentlich-rechtliche Verhältnisse sensationellen Dokumentarfilm meint?
Tatsächlich hatte die Atomforschung innerhalb der SS eine längere Tradition, die trotz aller quellentechnischen Lücken belegt werden kann: Bereits 1942 war in Anbindung an das SS-Wissenschaftsinstitut, das „SS-Ahnenerbe“, an der Reichsuniversität Straßburg ein Lehrstuhl für Kernphysik eingerichtet worden, dem auch ein Cyclotron zur Verfügung gestellt werden sollte. Ergänzend sollte die Karstwehr-Abteilung des „Ahnenerbes“ das in Höhlen entstehende Neueis auf die Anreicherung mit schwerem Wasser untersuchen, was allerdings verneint wurde.
Und auch die dem „Ahnenerbe“ unterstellten, aus Häftlingen in Sachsenhausen gebildeten Abteilungen für Mathematik und Physik arbeiteten bis zuletzt an Projekten, die mit dem Einsatz einer „entscheidenden Vergeltungswaffe“ im Zusammenhang standen. Der Forscher Igor Witkowski nennt als geheime Koordinierungsstelle innerhalb des Waffenamtes der Waffen-SS die Einrichtung „FEP“ (Forschungen, Erfindungen, Patente“), die Kernforschungszentren in Glau und in Pilsen unterhalten habe. Letzteres diente dabei auch der Entwicklung atomarer Antriebe.20
Gemäß dem letzten Forschungsstand können heute bis zu neun Standorte geheimer Nuklearforschung innerhalb des 3. Reiches eruiert werden:21
Standorte der Atom-Forschung
1. Truppenübungsplatz Ohrdruf und Jonastal in Thüringen
Angelegt seit 1940 umfaßte der gesamte Bereich eine Fläche von 750.000 m². Unterirdisch wurden hier Teile für die V2-Rakete produziert sowie Nuklear-Forschungen betrieben. Im nahegelegenen Stadtilm befand sich ein Versuchsreaktor, eine „Uranmschine“. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll hier auch an Rundflügelflugzeugen bzw. Flugscheiben gearbeitet worden sein.22
2. Anlage „Riese“ in Niederschlesien
Das Projekt Riese war ursprünglich – bis zum Beinahe-.Zusammenbruch der Ostfront im Sommer 1944 – als Führerhauptquartier vorgesehen, wurde seit 1943 als Verteidigungsbastion im Stil der späteren Alpenfestung ausgebaut. Hier befanden sich auf mehr als 213.000 m² unterirdische Produktionsstätten für Raketen und Düsenflugzeuge sowie eine Anlage für Nuklearforschung.
3. Objekt „Rüdiger“ bei Waldenburg in Schlesien
In dieser unweit der „Riese“-Anlage gelegenen kleinen unterirdischen Anlage nahe des Schloß Waldenburg wurden laut Autor Igor Witkowski Forschungen mit dem Projekt „Glocke“ betrieben.
4. Reichspost-Amt 2000 Groß-Rosen
Diese gemeinsam von der Reichspost und der SS in oberirdisch angelegten Baracken betriebene Einrichtung befaßte sich mit Hochfrequenzforschung.
5. Truppenübungsplatz Böhmen-Dessen
Zur Errichtung unterirdischer Anlagen auf dem Truppenübungsplatz Böhmen-Dessen, nahe der Stadt Stechowitz (Stechovice), soll eigens ein Fluß umgeleitet und ein Staubecken angelegt worden sein. Über die genaue Forschung der SS in dieser Anlage ist nichts bekannt, da die Alliierten diese Anlage aufgrund besonderer Sicherungsmaßnahmen nicht entdeckt hätten. Vor einigen Jahren wurden nahe Stechowitz noch immer geladene Batterien („Kammler-Batterien“) aufgefunden.
6. Anreicherungsanlage Joachimsthal im Erzgebirge
(Sudetenland)
Wenige Monate vor Kriegsende soll es zur Errichtung einer Anlage zur Ausbeutung der nahe Joachimsthal gelegenen Uranerzminen und Uranreicherung durch Teilchenbeschleuniger gekommen sein. Es wird spekuliert, daß hier die ursprünglich bei Hennigsdorf angesiedelte AEG-Neutronengenerator-Anlage unter Kommando der SS ein neues Domizil gefunden hat, die 1943 durch einen Bombenangriff schwer beschädigt worden war.
7. Skoda-Werke Brünn („Kammler-Denkfabrik“)
Eine Reihe von Forschungen erfolgte in den Skoda-Werken bei Brünn, wo verschiedenen Autoren zufolge bis Anfang 1945 die Fäden für die SS-Forschungen in einer Art Denkfabrik zusammenliefen.
8. Anreicherung- und Testanlage in Auschwitz
Ebenfalls in Zusammenhang mit der Urananreicherung wird immer wieder das Konzentrationslager Auschwitz genannt. Nachweisbar ist ein entsprechender Stromverbrauch, der über dem der Städte Berlin und Hamburg zusammen lag. Hier wurde auch Uraninit (Pechblende) in Uran umgewandelt.23 Am Ende des Krieges soll es auch zu einem Test gekommen sein, in dem Hunderte KL-Häftlinge umkamen.
9. Alpenfestungs-Anlagen Quarz u.a. (St. Georgen)
Obgleich oft als Mythos bezeichnet, liefen die Vorbereitungen zur Errichtung der Alpenfestung seit 1943. Am 24. April 1945 erließ Adolf Hitler einen Befehl, dem zufolge sämtliche noch verfügbare Kräften den Rückzug in die Alpenfestung antreten sollten. Dort waren bis Frühjahr 1945 neben Produktionsstätten für Raketen und Düsenflugzeuge auch Nuklearforschungsabteilungen nebst funktionsfähigem Reaktor eingerichtet worden.
Auszug aus der aktuellen Veröffentlichung:
Dennis Krüger: Wunderwaffen & Geheimprojekte