„Nach dem Sturze Roms hatten die germanischen Staatengründungen nicht nur beinahe ganz Europa bedeckt, sondern waren sogar noch tief nach Afrika bis zu den kanarischen Inseln gedrungen, wo das Volk der Wantschen sich als Reste der Vandalen erwiesen. Ja, selbst heute noch sind die Throne ganz Europas mit alleiniger Ausnahme des Sultanats von Stambul und des Königsthrones von Schweden (Bernadotte) im Besitze germanischer Familien, die wahrscheinlich eines gemeinsamen Ursprunges aus einem uralten Herrschergeschlechte sind, das in vorgeschichtlicher Zeit sein Entstehen fand.“
So formulierte der gebürtige Wiener Schriftsteller Guido von List bereits 1893 seine Ablehnung des damals herrschenden Bildes der Germanen.
„Wenn nun die staatengründende Macht des Germanentums allgemein anerkannt ist, wenn die hohe Weisheit seiner Theologie nachgewiesen werden kann“, so List in seiner Abhandlung „Über die Wuotanspristerschaft“ weiter,
„so muß nicht nur eine einheitlich geleitete Schulung der Geister, wie eine planmäßige Erziehung des Volkes durch Jahrhunderte hindurch ihre Wirkung geäußert haben, weit erhaben über jener Stufe der Halbwildheit, die man gewöhnlich annimmt, gestützt auf parteiische und gehässige Berichte aus römischen, griechischen und fränkischen Federn.“
Das Fazit von Lists: Das Volk der Germanen wurde geführt von einer Priesterschaft, die er als Wuotanspriester bezeichnet:
„Ist aber die hervorragende Machtstellung des vorchristlichen Wuotanspriesters erkannt, eine Machtstellung, welche der christliche Priester in Deutschland trotz aller Versuche nie zu erreichen vermochte, so ist es eben nur folgerichtig, daß er, der als sichtbarer Repräsentant der als Gipfelpunkt aller Idealbegriffe aufgefaßten Gottheit waltete, auch im Staate alle höchsten Würden bekleiden mußte. Darum vereinigte ein vorchristlicher deutscher König in seiner Person den Dreibegriff der göttlichen Macht, des Entstehens, Seins und Vergehens, indem er, als Priester, der Urzeit und des Urwesens weihevoll gedachte, als König, der Gegenwart waltete, und als Richter, die Folgen der Schuld zu verringern suchte. Daraus erklärt sich der sagenhafte göttliche Ursprung der Königsgeschlechter, von welchen Stamm-, Familien- und Wappensagen berichten, denn der Stellvertreter der Gottheit konnte nur ein Abkömmling derselben, ein „Köting“ sein. Daraus erklären sich auch die drei Nornennamen: Urda, Verdandi und Skuld, welche fehlerhaft für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedeutet wurden, richtiger aber aufzufassen sind als: Ursprung, das Werdende und Schuld. Die Schuld ist eben das selbstverschuldete Verhängnis der Zukunft, das der Richter durch Sühne und Buße nur zu mildern suchte, ohne Rache zu üben oder Strafe zu verhängen; dann der Deutsche kannte nur einen wohlwollenden, aber keinen rächenden, keinen zornigen Gott.“
Mit seinen Thesen über die hohe Kultur und Sittlichkeit der Germanen war von List einer der frühesten Pioniere eines positiven Germanenbildes, das sich durch die heutige Forschung bestätigt hat: Die direkten Vorfahren der Germanen schufen nicht nur die älteste plastische Darstellung des Himmels – die Himmelsscheibe von Nebra – sondern waren auch Meister der Bronzeverarbeitung und Begründer vieler antiker Reiche.
Eigentlich als Kaufmann ausgebildet, widmete sich der 1848 geborene Wiener schon früh der Kunst und hielt seine Eindrücke der Natur in Gemälden, in Prosa und Gedichtform fest. Nach dem Tod seines Vaters 1877 wurde er Schriftsteller. Seine Artikel, die vom Kampf der Germanen gegen die Römer und germanischer Mythologie handelten, wurden in verschiedenen völkisch ausgerichteten Magazinen veröffentlicht, darunter die Publikationen „Heimat“, „Deutsche Zeitschrift“ und „Neue Welt“. Seine Befassung mit heidnisch-germanischen Themen und der Natur mündete 1888 in seinem Roman „Carnuntum“, dem 1891 das zweibändige Werk „Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder“ folgte. Im Laufe der 1890er Jahre errichtete der Schriftsteller seine spezifische List-Mythologie, in deren Zentrum der Wotan-Kult („Wuotanismus“) und die Armanen-Priesterschaft standen. Kerngedanken dieses Mythologie-Bildes flossen in seine 1893, hier vorliegende Schrift „Von der deutschen Wuotanspriesterschaft“ und in sein 1898 erschienenes Büchlein „Der Unbesiegbare“ ein.
1902 hatte List dann ein einschneidendes Erlebnis: Nach einer Augenoperation zur Entfernung eines Grauen Stars erblindete er für elf Monate. In dieser Zeit, die er selbst einmal mit dem Leiden Wotans verglich, der während eines Martyriums die Runen „schaute“, wendete er sich verstärkt esoterischen Vorstellungen zu. Er konzipierte eine „arische Ursprache“ und Deutungen der Runen und anderer Symbole in alten Inschriften. Jeder der 18 Strophen des Hávamál (eine Sammlung von insgesamt 164 Strophen der Lieder-Edda) ordnete er eine Rune des Runen-„Alphabets“ (Futhark) zu und schrieb diesen jeweils eine bestimmte okkulte Bedeutung zu. Der „Pionier des völkischen Runenokkultismus“ (N. Goodrick-Clarke) reichte ein Manuskript über diese neuen „Erkenntnisse“ 1903 bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien ein, die es jedoch kommentarlos zurückschickte. Ein anderes Dokument der inneren Wandlung Lists ist ein Aufsatz über die esoterische Bedeutung religiöser Symbole, der 1903 in der theosophischen Zeitschrift „Die Gnosis“ erschien und von der Erschaffung des Universums handelte.
1907 ließ sich der Schriftsteller unter Berufung auf seinen Urgroßvater steirischen Adels den Adelszusatz „von“ in seinen Namen eintragen. Obgleich der Adel der Vorfahren quellenkundlich auf unsicheren Füßen stand, hatte List mit seinem Antrag Erfolg.
1908 verfaßte der stets die Einsamkeit der geselligen Runde bevorzugende Schriftsteller seine beiden Hauptwerke, „Das Geheimnis der Runen“ und „Die Armanenschaft der Ariogermanen“, in denen er sein mythologisches Konzept darlegte.
Obgleich wissenschaftlich ohne Bedeutung, prägte List die völkisch-esoterische Szene bis in die Gegenwart. Er verband den theosophischen Okkultismus mit der völkischen Lehre und schuf daraus die Grundlage, auf der sein Schüler Jörg Lanz von Liebenfels die „Ariosophie“ errichtete – eine okkulte, den Arier betreffende Weisheit. List unterschied zwischen dem exoterischen Wotanismus — der Religion der alten Ariogermanen — und dem esoterischen Armanismus, der den eingeweihten Priestern vorbehalten war. Sich selbst sah der als den letzten Magier der Armanen, der einstigen geistigen Führer oder Priester der „Ariogermanen“. In seiner Veröffentlichung „Die Armanenschaft der Ariogermanen“ interpretierte er zugleich die Einteilung der Germanen durch Tacitus als ständische Dreigliederung: Armanen (Irmionen) = Priester, Ingväonen = Adelige und Fürsten, Istävonen = Bauern und Handwerker. Ein weiteres Leitmotiv war die mystische Einheit des Menschen mit dem Universum. In Abgrenzung sowohl zum klassischen Heidentum als auch zum Christentum predigte List die Unsterblichkeit der Seele, die Reinkarnation und eine karmische, also schicksalhafte Vorherbestimmung. Daraus ergab sich die zentrale Forderung, in Einheit mit der Natur zu leben, wozu auch gehörte, sich selbst als Teil eines Volkes und einer Rasse zu betrachten. Dies, so die heutige Interpretation, war Lists Antwort auf die von ihm abgelehnte Moderne.
Auf einer Reise nach Brandenburg erlitt der gesundheitlich angeschlagene von List 1919 eine Lungenentzündung, von der er sich nicht mehr erholte. Am 17. Mai 1919 starb der Armane in einer Berliner Pension. Seine Graburne wurde in seiner Heimatstadt Wien auf dem Zentralfriedhof in den „Neuen Arkaden“ beigesetzt.
Im Forsite Verlag erhältliche Werke:
Von der deutschen Wuotanspriesterschaft
Ursprung und Wesen der Heraldik
Anmerkung: In einer früheren Version wurde ein Satz unsauber formuliert, so daß sinngemäß Guido von List die Ariosophie begründete. Tatsächlich wurde diese durch den List-Schüler Georg Lanz von Liebenfels gegründet, von List schuf lediglich eine Grundlage.

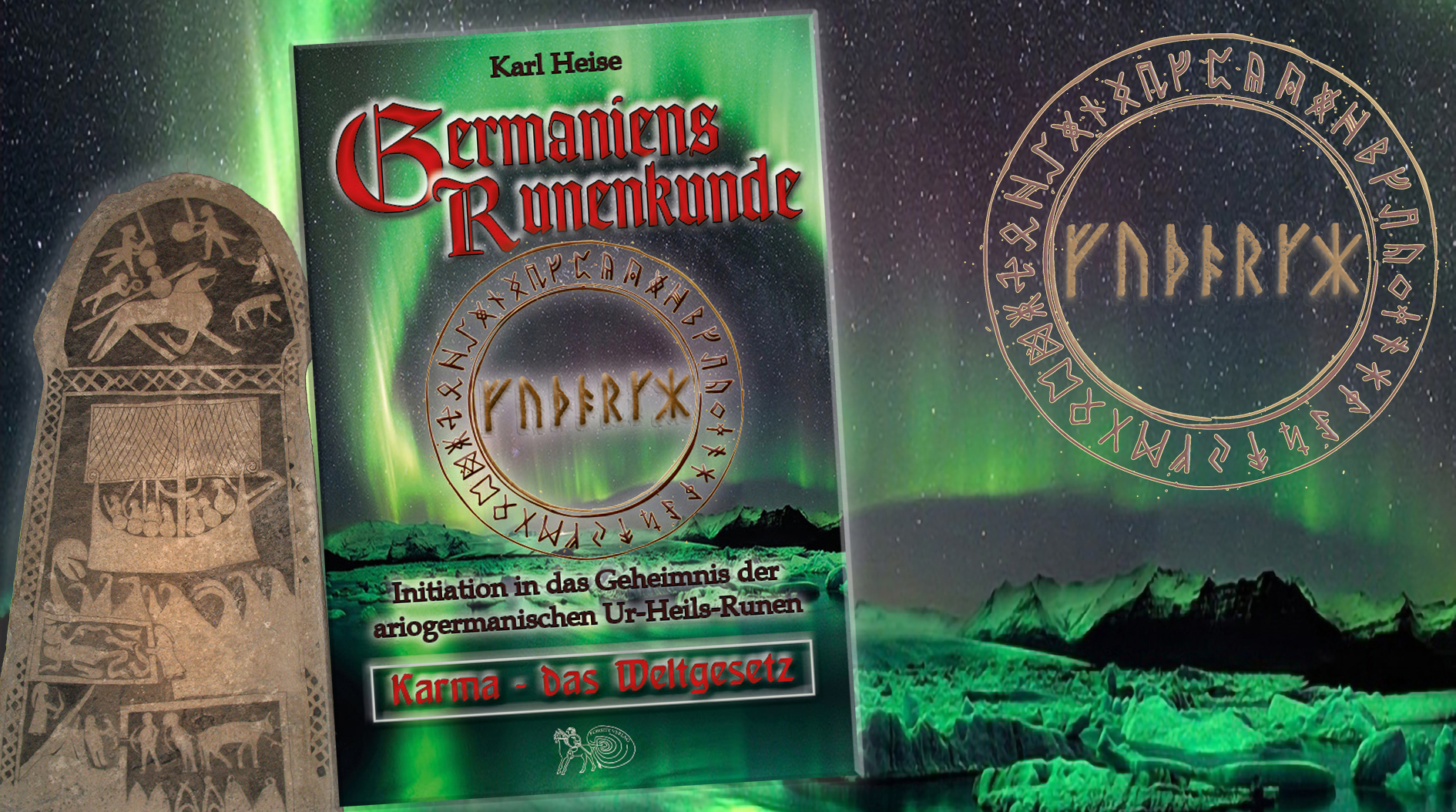
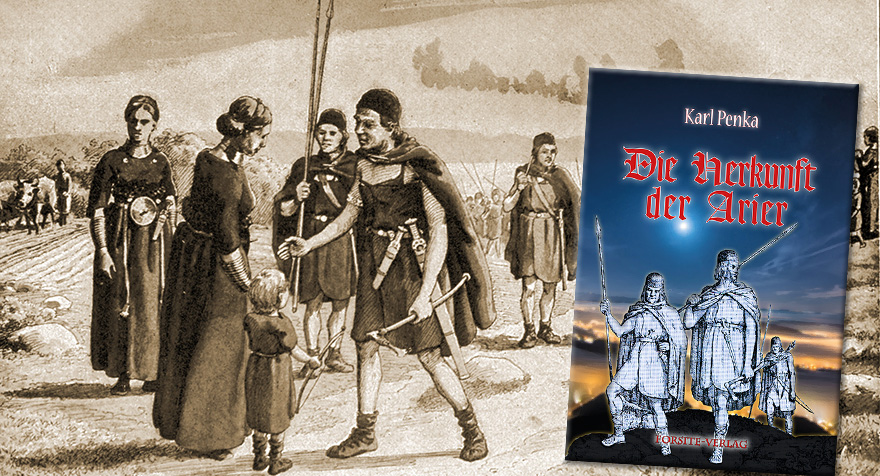

Woher nimmst du die Erkenntnis das Meister List die Ariosophie gründete????
Meister List gründete doch die Armanenschaft neu durch die Intuition des Armanismus in der 1905 gegründeten Guido von List Gesellschaft , die durch ihre eigentlichen (Mit)Gründer Wannieck und Meister Liebenfels entstand.
Die Früchte der Ariosophie entstanden an dem Baume des Meister Liebenfels, der dieses arische Weistum neu belebte!
Meine dringendsten Empfehlung dazu:
Guido von List Biographie: Johannes Balzli
Lanz von Liebenfels Biographie:
Horst Lorenz (Chronist des ONT)
Nichts für Ungut
ALAF SAL FENA
MM33