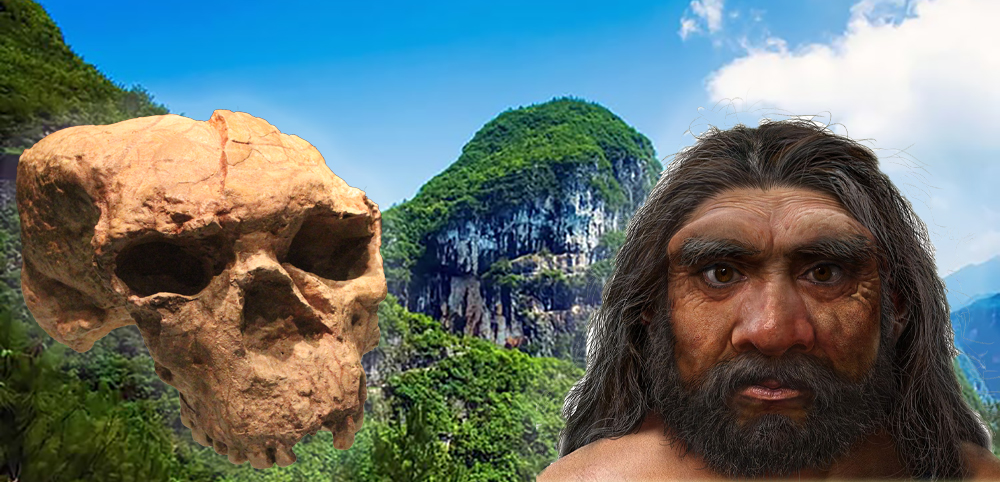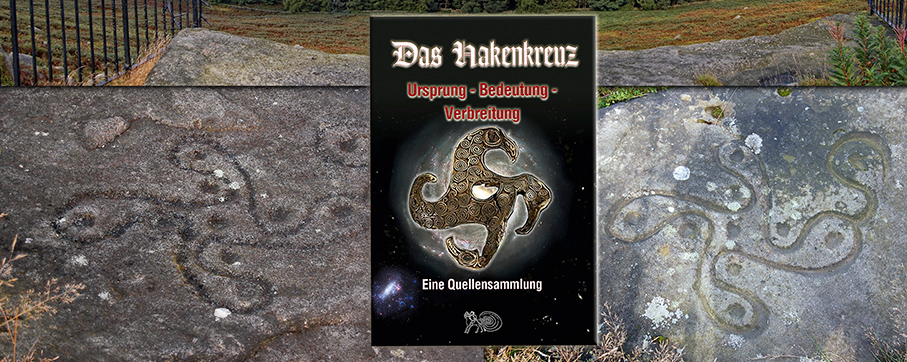Am 6. Mai 2025 jährte sich zum 140. mal der Geburtstag eines bedeutenden Frühgeschichte- und Symbolforschers: Herman Wirth.
Jugend und Ausbildung
Am 6. Mai 1885 als Sohn des aus der deutschen Rheinpfalz stammenden Gymnasiallehrers Ludwig Wirth und seiner holländischen Ehefrau Sophie Gijsberta, geborene Roeper Bosch, in Utrecht geboren, absolvierte Wirth erfolgreich seine Schullaufbahn und begann in seinem Heimatort ein Studium niederländischer Philologie, Germanistik, Geschichte und Musikwissenschaft. Nach einigen Semestern setzte er sein Studium in Leipzig fort, wo seine bereits durch den Vater geförderte Vorliebe für die deutsche Kultur weiter zunahm.
Nach Utrecht zurückgekehrt, bestand Wirth 1908 sein Staatsexamen und promovierte 1910 mit der Arbeit „Der Untergang des niederländischen Volksliedes“ an der Universität Basel beim dortigen Volkskundler John Meier zum Doktor der Philosophischen Fakultät („Dr.phil.“). Darauf ging er als Dozent für niederländische Philologie an die Berliner Universität, wo er sich neben volkskundlichen Studien auch für die niederländische Volksmusik engagierte. Die volkstümliche Musik nahm zu dieser Zeit einen breiten Raum im Wirken des jungen Forschers ein. Er verfaßte neben seiner Dissertation noch zahlreiche weitere Schriften und Artikel zur Musikgeschichte, darunter das Werk „Nationaal-Nederlandsche muziekpolitiek“ (Amsterdam 1912), das Heft „Ein Hähnlein woll‘n wir rupfen: Neue Kriegslieder nach alten Texten und Weisen“ (Jena 1914) sowie den Vortrag „Das niederländische Volkslied vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert im Rahmen der Geistesgeschichte“ (Leipzig 1915). Zusammen mit einer Gruppe begeisterter Anhänger organisierte er Veranstaltungen in denen früh-niederländische Musikdarbietungen mit Vorträgen kombiniert wurden.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges meldete sich Wirth freiwillig zum deutschen Militär. Aufgrund seiner niederländischen Staatsangehörigkeit setzte ihn das Militär in der Zivilverwaltung im deutsch besetzten Belgien in Gent ein, wo er als Verbindungsmann zu den – deutschfreundlichen – flämischen Separatisten fungierte. Hier engagierte er sich stark für die flämischen Belange – für einige deutsche Offiziere sogar so übertrieben, daß er noch 1915 von seiner Position abberufen wurde. Dennoch wurde Wirth nach seiner Rückkehr nach Berlin aufgrund seines pro-deutschen Engagements als gebürtiger Niederländer 1916 von Kaiser Wilhelm II. zum Titularprofessor ernannt.
1916 heiratete Wirth seine zweite Ehefrau Margarete, die er im Rahmen der niederländischen Musikveranstaltungen kennengelernt hatte. Die Tochter des Kunstmalers Prof. Eugen Vital Schmitt gebar ihrem Mann vier 1919, 1921, 1923 und 1929 geborene Kinder und stand dem Forscher als Lektorin und Zeichnerin zur Seite. Mit ihr teilte Wirth nicht nur weltanschauliche Positionen, sondern auch die Lebenseinstellung, darunter den Vegetarismus und die Abstinenz von Tabak und Alkohol.
Unabhängig von seiner deutschen Titulatur-Professur ohne weitere Rechte und Pflichten wirkte Wirth bis zum Kriegsende in Brüssel als flämischer Hochschullehrer und beteiligte sich an der Errichtung einer „Deutsch-Flämischen Gesellschaft“, in deren Rahmen auch eine „Großniederländisch-Deutsche Zeitschrift“ geplant war.
Nach dem Zusammenbruch 1918 gründete Wirth in den Niederlanden die bündische Organisation „Landsbond der dietsche Trekvogels“, eine niederländische Variante des Wandervogels. In diesem Zusammenhang erkannte er, daß der deutschen Jugend bei allem völkischen Enthusiasmus die eigentliche geistige Urgrundlage fehlte: „Denn daß die Edda keine ‚germanische Bibel‘ war – wie von ‚nordischen Glaubensbewegungen‘ damals (und sogar noch heute) mit tragischer Ehrfurcht angenommen wurde – das war mir soweit klar geworden. Aber was lag dahinter?“ Mit dieser Fragestellung verband sich der Beginn des „Suchens und Tastens“ zurück zur europäischen Geistesurgeschichte – lange vor dem Walhalla- und Götterglaube der Germanen.
Seit 1922 war Wirth als stellvertretender Studienrat am Humanistischen Gymnasium in Sneek im niederländischen Friesland tätig. In dieser Zeit kam er im Rahmen seiner Erforschung des Giebelschmucks der alten friesischen Bauernhöfe erstmals mit dem für seine späteren Forschungen wichtigen vier-, sechs- oder achtspeichigen Rad als „Rad der Zeit“ oder „Weltrad“ in Berührung und lernte die schon damals umstrittene Ura-Linda-Chronik kennen.
Annäherung an den Nationalsozialismus
Im Jahr 1924 ließ sich Wirth in Marburg nieder und errichtete das Haus Eresburg als Studienort. Hier fand er von 1924 bis 1926 eine Anstellung als außerplanmäßiger Assistent am Germanistischen Seminar.
1925 trat er der NSDAP bei, doch bereits 1926 folgte sein Parteiaustritt, dessen Begründung umstritten ist. Wirth selbst führte an, durch diesen Schritt der Bewegung von größerem Nutzen gewesen zu sein, da er dem Nationalsozialismus entgegenkommende Thesen ohne Vorwurf der Parteilichkeit propagieren hätte können. Andere Stimmen behaupteten demgegenüber, Wirth hätte zu dieser Zeit jüdische Gelder angenommen und werten dies als Beweis für seinen vorgeblichen Opportunismus. Wie sich der Austritt auch immer erklären läßt, sticht hier bereits Wirths eigenwilliger Charakter hervor, bei aller unumstrittenen geistigen Nähe zur NS-Bewegung auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, wenn er von deren Richtigkeit überzeugt war.
Bereits seit 1921 mündete Wirths Interesse an den Grundlagen der germanischen Kultur in volkskundlichen und frühgeschichtlichen Forschungen, in deren Mittelpunkt die Sinnbild- und Kultsymbolik stand.
Mit seinem 1928 bei seinem langjährigen Förderer Eugen Diederichs in Jena veröffentlichten Werk „Der Aufgang der Menschheit“ begeisterte er weite Kreise der völkischen Anhänger und inspirierte auch führende NS-Protagonisten. Durch die Deutung des Hakenkreuzes als „arteigenem Heilszeichen” bereitete er auch – gemeinsam mit anderen Forschern – dem späteren Symbol des Dritten Reiches ein theoretisches Fundament. Zugleich avancierte der Forscher zu einem von den Medien gelobten Autor. Ein Forscherkollege beschreibt Wirth in dieser Zeit wie folgt: „Wirth macht auf den ersten Blick einen sympathischen, aber unbedeutenden, vielleicht etwas überspannten Eindruck. Er ist kleinwüchsig, aber im Übrigen der Typ eines Vollblutgermanen. Die Kleidung ist gepflegt, doch originell: Kniebundhosen, grüne Jacke mit schwarzem Samtkragen, buschiger Schnurrbart im Nitzscheanischen Stil sowie ein Urwald goldener Locken, die gern ins Gesicht fallen. Seine Sprache ist elegant und fließend, und ein Ausländer merkt kaum, daß er gebürtiger Holländer ist.“
Im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der Herman-Wirth-Gesellschaft“ welche den grundlegenden Thesen Wirths eine weitere Verbreitung verschaffen sollte – die Abstammung noch heute weltweit anzutreffender Sinnbildsymbolik von einer jungpaläolithischen Kultur, die bereits einen auf dem Sonnen-Jahreslauf basierenden (Ur-)Monotheismus und Lichtbringerglauben besessen hätte und identisch mit der atlantisch-nordischen Rasse wäre, die ihren Ausgangspunkt aus einem subarktischen Ursitz („Thule“) genommen hätte. Die weltweit verbreiteten Zeichen deutete Wirth als „vergeistigte Urbilder“, die zugleich Urschrift, Urkultur und Ursymbolik verkörperten. In Wirths Worten in einem Satz zusammengefaßt, „daß die Religion der nordatlantischen Tuatha-Völker, „jener „Leute“ oder „Deutschen“ der fernen Vorzeit eine monotheistische war, ein Glaube an den Welten- und Himmelsgott.“
Allerdings gab es schon früh Gegenstimmen, auch aus den Reihen der völkischen Bewegung. Die Gattin des Weltkriegsmarschalls und NSDAP-Mitglieds Erich Ludendorff, Mathilde Ludendorff, kritisierte den Marburger Forscher in der „Deutschen Wochenschau“ scharf. Herman Wirth wandte sich darauf in einem offenen Brief an Graf Ernst zu Reventlow (9.9.1929) und schrieb u. a., der Angriff der Nationalsozialisten gegen das Judentum sei eine Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe der inneren Erneuerung des deutschen Volkes. „Die ausschließliche Behandlung der jüdischen Frage in diesem Sinne der Schuldfrage“, so Wirth damals, „birgt eine große Gefahr für das nordische Erwachen in sich als Ablenken von der eigenen Verantwortlichkeit und Selbsterkenntnis.“
Auch fachlich stieß Wirth auf starken Gegenwind. Seine Bemühungen um eine akademische Habilitation scheiterten am Widerstand der wissenschaftlichen Zunft, deren Einstellung gegenüber dem Marburger Forscher die Bewertung des Prähistorikers Gero von Merhart widerspiegelt: „Nur das Empfinden, daß der Verfasser des Buches [Der Aufgang der Menschheit] von einem fast heiligen Wahn befallen ist… und die Feststellung, daß er mit ungewöhnlichem Eifer und Fleiß eine beachtliche Literaturmasse durchsucht hat, um seinen Wahn mit dem zu stützen, was er für Wissenschaftlichkeit hält, halten mich ab, auf meine sonstigen Gefühle beim Durchlesen eines Großteils dieses Buches mit einer meinem Temperament gemäßen Grobheit zu reagieren.“
1929 hielt Wirth einen Vortrag in München, bei dem auch Hitler mit einigen Parteifreunden, darunter Alfred Rosenberg, sowie das Verlegerehepaar Bruckmann anwesend waren. Im Anschluß an den Vortrag soll laut einem Weggefährten Wirths Hitler Frau Bruckmann das Buch „Der Aufgang der Menschheit“ mit folgender Widmung übergeben haben: „Wirth ist für mich der lebendigste Wissenschaftler. Ich warte nur darauf, daß dieser Mann zum Volke spricht. Nach der Machtübernahme werde ich sein und Klages‘ Werk durch Lehrstuhl und Institut sicherstellen.“
1932 führte Wirths Nähe zur NSDAP, die sich auch in einem Wahlaufruf Wirths zugunsten der Partei 1932 im „Völkischen Beobachter“ widerspiegelte, zur Gründung des „Forschungsinstitutes für Geistesurgeschichte“ in Bad Doberan auf Betreiben der nationalsozialistischen Landesregierung von Mecklenburg-Schwerin. Hier scharte der Forscher einen Kreis von Unterstützern um sich, die später auch im „Deutschen Ahnenerbe“ wirkten, darunter Otto Huth, Werner Müller, Joseph Otto Plassmann und den späteren Ahnenerbe-Sekretär Wolfram Sievers. Eine von der mecklenburgischen Regierung in Aussicht gestellte Habilitation als Professor für Vorgeschichte an der Universität Rostock scheiterte jedoch erneut am Widerstand einiger Fachgelehrter.
Bereits einige Jahre zuvor hatte Wirth den Gedanken gefaßt, eine Freilichtschau und Sammlung für Geistesurgeschichte und Volkstumskunde zu errichten, die unter dem Namen „Deutsches Ahnenerbe“ eine Art „deutscher Ahnenhein“ darstellen sollte. Trotz langjähriger Bemühungen und mehrerer Anläufe – u. a. im Kunersdorfer Forst bei Potsdam 1933 – sollte diese Idee ein Wunschtraum bleiben. Stattdessen eröffnete Wirth im März 1933 in der Potsdamer Straße in Berlin die auf einen Monat angesetzte Ausstellung „Der Heilbringer – Von Thule bis Galiläa und von Galiläa bis Thule“, in der das nordische „Urchristentum“ thematisiert wurde, das das spätere Christentum inspiriert habe. Die Ausstellung umfaßte von Wirth als „Denkmäler des nordischen Kulturkreises und Geisteserbes“ erkannte Exponate und verdeutlichte, daß die „Edda zwar eine schöne Skaldendichtung war, aber nicht die germanische Religion darstellte.“
Aufgrund des großen Zuspruchs folgte im Juni 1933 auf Einladung des Kaffee-Fabrikanten Roselius eine Fortsetzung der Ausstellung im neueröffneten „Haus-Atlantis“ in der Bremer Boettcherstraße. Zugleich wurde dort die Vortragsveranstaltung des „Nordischen Things“ abgehalten, auf der auch Wirth einen Vortrag hielt, der zu Kontroversen führte.
Die Reaktionen auf die Präsentation von Wirths Forschungsergebnissen waren auch unter Anhängern des Nationalsozialismus zwiespältig. Insbesondere Wirths Ansicht, daß die Zukunft Deutschlands, Europas und im Grunde der ganzen Menschheit davon abhängt, ob der Mann der Frau ihre Stellung zurück gibt, die er ihr einst genommen hatte, wurde überwiegend abgelehnt. Denn, so Wirth, „sie stand einst nicht nur neben ihm, sondern sie war auch seine Rätin“. Damit mußte er zwangsläufig auch den Widerspruch Rosenbergs heraufbeschwören, der der Frau lediglich eine passive Rolle in der Geschichte zugestehen wollte.
Begegnung mit Heinrich Himmler
Inzwischen hatte Wirth zum 1. November 1933 eine Anstellung an der Universität Berlin in Form eines Extraordinats an der Theologischen Fakultät erreicht, die ihm ein monatliches Gehalt von fast 800 RM sicherte.
Mit Wirths Eintritt für einen „wahren Quellenkern“ der Ura-Linda-Handschrift (ULH), die er 1933 mit einem Kommentar veröffentlichte, steigerte sich indes die Polarisierung um den umstrittenen Forscher weiter. Die Mehrzahl der akademischen Frühgeschichtsforscher wandte sich gegen Wirth, nur wenige anerkannte Fachleute nahmen ihn in Schutz – etwa der Prähistoriker Gustav Schwantes, der von einem „Funken echten Geniums“ Wirths sprach. Hauptkritikpunkt der Kritiker Wirths waren dabei vor allem Passagen innerhalb der Chronik, die sich nicht mit dem herrschenden Frühgeschichtsbild nationalsozialistischer Frühgeschichtsforscher deckten sowie die vielen neuheidnischen ausgerichteten Forschern aufstoßende Nähe zum Christentum, zugleich aber auch Wirths aus der ULH abgeleitete Überzeugung von der großen Bedeutung des Weiblichen in der nordischen Frühzeit, die sich in einer matriarchal geprägten Gesetzgebung und Rechtsprechung manifestiert hätte.
Trotz dieser den Plänen Himmers zur Errichtung eines SS-Männerordens auf den ersten Blick entgegenstehenden Ansätzen Wirths, war der SS-Reichsführer nach Bekanntschaft des Marburger Forschers durch Vermittlung Johannes von Leers den Forschungen Wirths gegenüber empfänglich. Obgleich aufgrund der innerhalb der NSDAP ausgebrochenen Kontroversen um Wirth das Forschungsinstitut für Geistesurgeschichte in Bad Doberan nach Streichung der Gelder 1933 wieder geschlossen werden mußte, unterstützte Himmler gemeinsam mit Richard Walther Darré die Einrichtung neuer Ausstellungen. Im Mai 1935 wurde die Ausstellung „Der Lebensbaum im Germanischen Brauchtum“ im Gebäude des Reichsnährstandes eingerichtet.
Aus Herman Wirth: Leben – Werk – Wirkung